Verzeichnis der Veröffentlichungen
PDF: Verzeichnis der Veröffentlichungen
ZeitGeister | Philosophische Praxis
Akademie für Philosophische Psychologie


Gustave Moreau: Pasiphaé. Musée Gustave Moreau, Paris.—Quelle: Public Domain via Wikimedia.
Die Nähe zum pandämonischen, panpsychischen oder auch zum polytheistischen Weltbild liegt fast schon auf der Hand: Stets werden wir nämlich ergriffen von fremden Mächten und von überpersönlichen Motivationen. Daher ist die Vorstellung so naheliegend, als würden wir eingenommen von dämonischen Mächten, die Besitz von uns ergreifen, um ihre Motive zu den unseren zu machen.—Insofern sind wir wohl nicht wirklich Herr unserer selbst, denn wer sucht sich schon die eigene Grundstimmung, die Grundgefühle und vor allem auch die Gefühlsschwankungen selbst aus. Götter verkörpern nicht nur Emotion, von denen wir uns bewegen lassen, sie geben sie mitunter auch ein.
Götter können sich rächen, indem sie unwiderstehliche Neigungen eingeben: König Minos von Kreta hatte einen eigens von Poseidon geschaffenen Stier mit außergewöhnlich herrlicher Gestalt dem Meeresgott auf dessen ausdrücklichen Wunsch nicht geopfert, sondern zur Veredlung der eigenen Herde verwandt. Darauf ließ Poseidon die Ehegattin des Minos Pasiphae in heißem Begehren zu jenem Stier entbrennen. Der sagenumwobene Erfinder Dädalus wurde gerufen, der eine hölzerne Kuh konstruierte. Die Königin kriecht hinein, läßt sich von diesem Stier begatten und gebiert darauf den Minotaurus, der später dann im Labyrinth gefangen gehalten und von Theseus unter Mithilfe von Ariadne getötet wird.
Weil Minos dem Neptun einen Ochsen nicht opferte, welchen er ihm doch versprochen hatte, so habe sie sich in denselben verlieben müssen. Ihre Brunst wurde auch eher nicht gestillet, als bis Dädalus eine Kuh von Holze verfertigte, solche mit einer Kuhhaut überzog, und die Pasiphae hinein steckete. (Benjamin Hederich: Gründliches mythologisches Lexicon. Leipzig 1770. S. 1899.)
Manches spricht dafür, die Götter des Pantheon zu sehen als das, was sie von Anfang an waren, Allegorien für alle erdenklichen menschlichen Belange. In ihrer Gesamtheit verkörpern sie alles, was an Motiven, Interessen, an Schicksalsschlägen, Schwächen oder auch Stärken, Fertigkeiten und Talenten eine Rolle spielen kann.
Wenn dementsprechend genauer gefragt wird, etwa, was denn eigentlich hinter der Empathie steht, und was denn dann die Sehnsucht der Sehnsucht ausmacht, dann könnten wir weiterkommen in dieser Frage, wenn uns ein Gott dazu einfiele, der zuständig zu sein scheint.—Die Kunst, mit der verwirrenden Vielfalt eines Götterhimmels umzugehen, liegt eben darin, hinter den Allegorien der Götter ihre Zuständigkeiten zu eruieren. Die Frage wäre also: Welcher Gott verkörpert eigentlich die Sehnsucht der Sehnsucht und wie gehen Götter ihrerseits damit um, Träume zu haben, die sie womöglich selbst nicht leben können, etwa weil es zu ihrer Rolle und zu ihrem Selbstverständnis einfach nicht paßt.

Jules–Joseph Lefebvre: Diana.—Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons.
Die Biographie der Götter, also ihre Theographie ist oft hilfreich, um herauszubringen, was sich hinter der Allegorie eines Gottes oder einer Göttin verbirgt. Alle diese Figuren sind unsere Projektionen, daher ist es interessant, dem nachzugehen, was denn da projiziert und idealisiert worden ist. Dementsprechend darf stets mit höchst interessanten Korrespondenzen zwischen der Menschenwelt und dem Götterhimmel gerechnet werden.
Immerhin geht es um fundamentale Erfahrungen und Selbsterfahrungen, die mithilfe von Götterfiguren in Szene gesetzt werden: So steht die griechische Artemis und die mehr oder minder identische römische Diana für einen ganz bestimmten Kontext, der tief in die Vergangenheit der Menschengeschichte zurückreicht.
Diana ist auf den Bildern beim Bade unter den vielen nackten Nymphen sicher an ihrem Diadem zu erkennen, das eine Mondsichel trägt, ein wahrhaft uraltes Symbol. Damit läßt sie sich einer sehr viel älteren Epoche der Menschheitsgeschichte zuordnen, was allerdings kaum verwunderlich ist. Als Jagdgöttin steht sie allegorisch für genau jene Lebensweise ein, wie sie zuvor in der gesamten Geschichte der Menschheit vorherrschend war. Erst vor etwa 45.000 Jahren kamen die ersten Hirtennomaden auf und erst seit rund 12.000 Jahren kam es zum Prozeß der Zivilisation.—Wenn daher die Diana auftritt, so verkörpert sie einen ganz bestimmten Aspekt in der Subsistenzweise von Sammlern und Jägern, und dabei kam das Jagen den Männern und das Sammeln den Frauen zu.
Die Göttin steht für diesen eigentümlichen Flow, für die intensive Erfahrung von Einsamkeit in den endlosen Wäldern, Wiesen und Feldern, auf der Jagd aber auch beim Sammeln. Sie ist die Göttin des ›Draußen‹ und bewahrte insbesondere die Frauen vor den Gefahren, die damit einhergehen, sich weit weg zu wagen von allem, was noch in der Nähe der Gemeinschaft liegt. Da sind nicht nur natürliche Gefahren, sondern auch die, eventuell anderen Jägern zu begegnen, die vielleicht auf Frauenraub aus sind. Darüberhinaus ist es immer auch ein seelisches Wagnis, sich tief in die Wildnis vorzuwagen, weil man sich eben zugleich auch auf das eigene Innere einläßt. Nicht von ungefähr ist in der Weltanschauung der Wildbeuter alles beseelt und voller Geister und Dämonen.
Diana ist eine Schutzgöttin, die denen ganze besonderen Beistand gewährt, die sich sehr in die Wildnis vorwagen. Denn sie demonstriert das unermüdliche Jagen und sie bewahrt ihre Identität, so daß sich die, die sich auf die Einsamkeit in den Wäldern und auf alle erdenklichen Erfahrungen und Gefahren einließen, sich geborgen fühlen konnten. Die Göttin lebt vor, was es bedeutet, auf Jagd oder zum Sammeln in die Wälder zu gehen, weitab vom Lager, vielleicht in kleinen Gruppen, auf jeden Fall aber auf sich allein gestellt und nicht sonderlich wehrhaft.—Erstaunlicherweise wird die göttliche Allegorie für das Jagen und Sammeln ausgerechnet von einer jungfräulichen Göttin verkörpert. Das muß zu denken geben, denn gerade vom Jagen würde man doch annehmen wollen, da es doch eine eminent ›männliche‹ Tätigkeit ist, daß infolgedessen auch ein männlicher Gott dafür einstehen müßte.
Allerdings hat es mit den Umständen beim Jagen und Sammeln eine ganz eigene Bewandtnis. Nicht selten herrscht Enthaltsamkeit im Lager, während die Jäger weitab auf Beutefang sind. Und nicht anders ergeht es den Sammlerinnen, wenn sie in kleinen Gruppen unterwegs sind, ständig verfolgt von Gefühlen wie Angst, Bedrohung und Horror.—Sich überhaupt auf solche Wagnisse einzulassen, dafür steht diese Göttin, denn sie demonstriert, wie es gemacht wird.
Die Aufmerksamkeit dürfte nicht selten hoch angespannt gewesen sein, etwa anhand von Geräuschen die Nähe von Raubtieren frühzeitig zu bemerken. Aber nicht nur äußerliche, sondern auch psychische Gefahren sind in solchen Situationen zu bewältigen, die sehr viel Disziplin, Selbsterfahrung und Wagemut erfordern.—Vor allem für die Frauen dürfte noch entscheidender gewesen sein, daß sie ernsthaft befürchten mußten, weitab vom Lager eventuell von fremden Jägern aufgespürt, geraubt und entführt zu werden.
So ergibt sich dann der Charakter dieser Göttin. Sie muß so sein wie sie ist, ständig auf der Jagd, auf gutem Fuße mit allen Naturgeistern wie den Nymphen, aber völlig bei sich und nicht im mindesten an Liebesabenteuern oder gar Sex interessiert.—Dagegen gilt Diana rein äußerlich als äußerst attraktive, jugendliche, ungemein umtriebige aber auch absolut unnahbare Göttin. Alle wissen, daß sie sich für Männer wirklich nicht interessiert. Aber immer wieder gibt es alle erdenklichen Nachstellungen, denen sie sich systematisch und stets erfolgreich entzieht, nicht selten unter Einsatz von Mitteln, die der eigenen Weiblichkeit eine Tarnung verpassen, die augenscheinlich ist. Sie nimmt auch schon einmal die Gestalt eines Hirschs an, um Nachstellungen zu entgehen, so daß sich ihre Verfolger gegenseitig erschießen. Ihre Selbsttarnung geht so weit, daß sie ihren weiblichen Reize vollkommen negiert:
Als ihr Alpheus einst zu Leibe gieng, so beschmierete sie sich mit
den übrigen Nymphen das Gesicht dergestalt mit Kothe, daß er sie
unter dem Haufen nicht kennen konnte. (Benjamin Hederich:Gründliches mythologisches Lexicon. Leipzig 1770. S. 909.)
Die Götter im Olymp seufzen nicht selten, wenn sie sie überhaupt zu Gesicht bekommen, weil sie unentwegt in den Wäldern umherstreift, während sie sich stattdessen lieber wünschen würden, daß sie doch nicht immerzu jagen möge, sondern sich den ›schöneren Dingen‹ des Lebens endlich auch einmal mehr widmen sollte.—Diana steht in krassem Widerspruch zur Zivilisation, sie ist nicht von ungefähr andauernd in der Gesellschaft von Nymphen. Dem Pan müßte sie eigentlich sehr zugetan sein, aber der Gott der Wildnis ist sterblich, weil er im Zuge der Zivilisation seine Macht verliert, seit es auf diesem Globus gar keine Wildnis mehr gibt.

Hans Makart: Die fünf Sinne. Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Österreichische Galerie Belvedere, Wien.
Wer sich mit Äußerlichkeiten zufrieden gibt und glaubt, auf dieser Grundlage bereits umfassende Urteile abgeben zu können, wird nur angepaßtes Denkens zelebrieren. Da ist dieser Hang, sich nie und nimmer persönlich auf die Sachen selbst einzulassen. Es scheint, als würde man bereits ahnen, daß viele Gefahren damit einhergehen, wollte man dem Anspruch auf persönliche Urteile tatsächlich gerecht werden. Aber nichts dergleichen findet wirklich statt: Das Denken wird nicht aufgeschlossen, sondern, noch ehe es überhaupt in Gang gekommen ist, sofort wieder stillgestellt und auf Üblichkeiten fixiert. Eigenes Denken, Aufmerksamkeit, Empathie,—alles was mit hohem, höherem oder höchstem Anspruch daherkommt, ist dann nur noch Attitüde.
Die Kunst, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, kommt in der Regel nicht einmal im Ansatz zur Anwendung. In den herrschenden Diskursen geht es zumeist nur darum, sich gemeinschaftlich zu erregen, sich an Feindbildern zu orientieren, vor allem an jenen, die ganz gefährlich anders sind. Aber die eigentlichen Gefahren kommen gar nicht von außen, sondern von innen. Es sind Ängste im Spiel, die sich vor den unendlichen Weiten, vor den Unberechenbarkeiten und Ungewißheiten in der eigenen Psyche herrühren. Der Ungrund wird sehr wohl gespürt und geahnt, daß es gar keine Gewißheiten sind, von denen wir getragen werden.—Wer sich wirklich auf das offene Denken einläßt, wird sich selbst überzeugen, überraschen, ja sogar überholen, wird immer weniger Parteigänger, wird sich stattdessen auf die Ängste im eigenen Inneren einlassen müssen.
[gview file=„Nennen-Empathie.pdf” save=„1”]

Bezaubernde Bilder bezeugen, wie innig die Philosophie allem zugetan ist, was Flügel verleiht.
Bei Hegel beginnt die Eule der Minerva ihren Flug erst in der Dämmerung. – Platon schildert das Aufsteigen zur Erkenntnis mit der Allegorie vom Seelenwagen, bei dem es darum geht, am Triumphzug der Götter über das nächtliche Firmament, quer über die Milchstraße bis hin zum Reich der Ideen teilnehmen zu können. Aber den allermeisten Zeitgenossen fehle es dabei an „Federn”, auch beherrschen sie nicht die Selbstführung…
Die Gedanken sind frei, es kommt darauf an, sie schweben, fliegen und aufsteigen zu lassen. Es kommt darauf an, daß sie stets offen bleiben, sich inspirieren zu lassen.
Philosophischer Salon Karlsruhe


Philosophische Ambulanz Karlsruhe
Philosophischer Salon | B‑Side-Festival 2019 | Münster












Wenn herkömmliche Orientierungen unsicher werden, dann stellen sich Fragen der Selbstorientierung. Neue Antworten lassen sich jedoch erst finden, wenn zuvor genügend Abstand genommen wird. Erst aus der Distanz läßt sich das Ganze umfassend in den Blick nehmen. – Nur so kommt das Neue ins Denken und dazu ist Philosophie unverzichtbar. Philosophieren bedeutet, sich durch eigenes Denken zu orientieren, gerade dann, wenn vieles in der Schwebe ist.
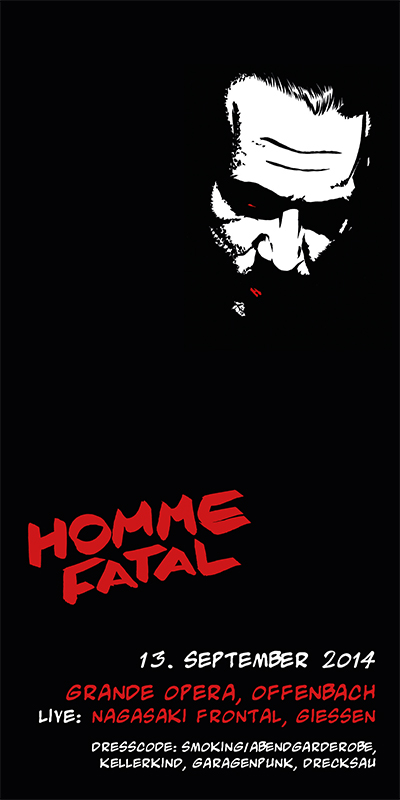
Neben dem philosophischen Dialog als intensiver Form, sich in Themen von existentieller Bedeutung einzufühlen, um sie zu erörtern, bietet das Philosophische Café die Möglichkeit, auch in größeren Gruppen tiefer miteinander ins Gespräch zu kommen. – Es gilt, nicht einfach nur die üblichen Standpunkte zu vertreten, sondern alle erdenklichen Positionen vorbehaltlos zu erörtern. So wird die Sache selbst allmählich gemeinsam entwickelt und nicht selten lassen sich ihr ganz neue Seiten abgewinnen. Manches erscheint dann in anderem Licht, so daß sich auch für die eigene Stellungnahme ganz neue Perspektiven eröffnen.
Das Philosophische Café versteht sich als Forum für eine Philosophie, die erst im gemeinsamen Gespräch aufkommen kann. Das Thema wird in der Regel nicht vorgegeben, es ergibt sich zwanglos fast wie von selbst. Der Gang des Gesprächs ist offen und dabei ist es nicht so entscheidend, wie sich andere Philosophen bereits dazu geäußert haben. Gewiß ist es anregend zur Kenntnis zu nehmen, was bereits gesagt worden ist, aber viel wichtiger ist es, sich selbst beim gemeinsamen Philosophieren zu erfahren.
Überzeugungen sollen nicht einfach nur vertreten, sondern dargelegt werden. Die Situation ist handlungsentlastet, nichts muß beschlossen werden. Niemand muß sich überzeugen lassen, denn wir überzeugen uns ohnehin immer nur selbst. Entscheidend ist, das eigene Denken an den Tag zu legen. Erst dann wird jene Freiheit spürbar, von der die Höhenflüge der Philosophie getragen werden. – Philosophie hat eben auch ihre Praxis: Es ist die Freude daran, wie unterschiedlich die Perspektiven doch sein können.
Kaum eine davon ist ohne Berechtigung, aber nur wenige davon sprechen wirklich fürs Ganze. Es gibt viele aber nicht unendlich viele Hinischten, aus denen sich dieselbe Sache betrachten läßt. Entscheidend sind daher vor allem solche Hinsichten, die in der Sache weiter bringen und helfen, besser zu verstehen, worauf es ankommen könnte.
Für den Gang solcher Untersuchungen prägte Hegel das Bild vom Flug der Eule der Minerva und bei Platon findet sich die Allegorie vom Seelenwagen. Diese bezaubernden Bilder bezeugen, wie innig die Philosophie allem zugetan ist, was Flügel verleiht, weniger um abzuheben, sondern um einen guten Überblick und neue Einblicke zu erhalten. – Alles was Flügel verleiht, hat daher einen symbolischen Bezug zur Philosophie, weil Federn zum Schreiben taugen, weil sie Gedanken beflügeln und weil dann nur noch die notwendige Seh‑, Erkenntnis- und Urteilskraft dazu gehört, um erkennen zu können, was sich in der Dämmerung abzuzeichnen beginnt.

Das ultimative Ziel solcher Reisen ist Platon zufolge eine Expedition ins Reich der Ideen. Beim Ausritt zusammen mit den Göttern über das nächtliche Firmament alle 10.000 Jahre kommt es darauf an, sehr schwere Himmelspassage zu bestehen, mit einem allzu menschlichen Gespann aus einem guten und einem schlechten Pferd. Viele stürzen dabei ab und fallen unmittelbar wieder ins Sein ohne sich wiedererinnern zu können. – Erst hinter dieser schwierigen Himmelspassage würde man zusammen mit den Göttern die Ideen anschauen.
Es kommt darauf an, die Kunst des Schwebens zu beherrschen. Dazu braucht es ‚Federn‚und die wachsen nur denen die lieben, denn die Liebe in ihrem heiligen Wahn soll wiederum Ähnlichkeit haben mit dem, wie denen zumute ist, die die Ideen erschauen. Und Platon zufolge verleiht gerade die Philosophie solche Flügel, schließlich geht es ihr – nicht nur dem Namen nach, um die Liebe zur Weisheit.
Solche Gespräche sind dazu angetan, die Sache selbst wie eine Feder durch den Atem aller, die mitreden und mitdenken, in der Schwebe zu halten, um beim gemeinsamen Philosophieren wie im Flug ins Reich der Ideen unterwegs zu sein.

Von Tobias Winkler, winklerwirred

Der Karlsruher Hochschullehrer für Philosophie, Dr. Heinz-Ulrich Nennen, steht regelmäßig mit seinem amerikanischen Wohnmobil in Münsters Hafen. Denn das Leben dort schreibt seine Vorlesungen. In den Pausen lädt er als „ambulanter Philosoph“ zur kleinen Denkerrunde übers Denken.
In den frühen Morgenstunden, so gegen fünf Uhr, da findet er es hier am schönsten. „Wenn sich der Hafen im glatten, stillen Wasser spiegelt“, erzählt er verträumt, „da erlebt man diesen kleinen Mikrokosmos gleich doppelt.“ In diese „kleine eigene Welt“ ziehe er sich seit fast vier Jahren gerne zurück. Heinz-Ulrich Nennen arbeitet als Hochschullehrer an der Universität Karlsruhe. Aber sein mobiles Büro steht immer wieder an Münster Hafenufer.
Ein amerikanischer „Winnebago“. Es ist ein großräumiges, silbernes Wohnmobil: Baujahr 1988, mehr als elf Meter lang, geparkt direkt am Kanalufer gegenüber der bunten Gastro- und Flaniermeile des alten Münsteraner Industriehafens. Es ist ein schönes, stattlich ausgebautes Modell mit allem Schnick und Schnack an Bord. „Ich will mich hier komplett heimisch fühlen und auf nichts verzichten“, erklärt Heinz-Ulrich Nennen. „Ich habe lange nach diesem Wohnmobil gesucht. Es ist das einzige Modell, das diesen Luxus bietet.“ Nun ist der Winnebago sein „kleines Denkbüro“, wie er ihn liebevoll nennt. Er ist sein mobiles Schneckenhaus.

Oft steht dieses nahezu stationär wie ein Fertighaus auf Rädern auf den ausgedienten Gleisen neben einem alten Hafenkran, der längst demontiert ist und an ein reges Leben der Hafenarbeiter erinnert. Oder im Wohnmobilhafen eines benachbarten Campingplatzes. Denn das mächtige Gefährt frisst zu viel Sprit, um darin ständig unterwegs zu sein. Will Nennen wirklich mobil sein, steigt er auf ein anderes Verkehrsmittel um. In Münster selbst ist er oft mit dem Fahrrad oder dem Auto unterwegs. „Nur zu Fuß gehe ich ungern“, fügt er hinzu. Geht es weiter weg, nimmt er die Bahn. Bis ins südliche Karlsruhe sind es immerhin mehr als vierhundert Kilometer, die Nennen – zumindest in der warmen Jahreszeit – nahezu jede Woche zurücklegt. Die Hälfte der Woche philosophiert er mit seinen Studenten, die andere Hälfte sucht er neues philosophisches Futter am münsterschen Kanalufer.
„Gegen halb sechs bringt die erste Welle das Leben zurück. Ganz langsam kommt sie herein“, führt er fort. „Man kann zuschauen, wie sie kommt, vorbeiläuft, vom anderen Ende wieder zurückkommt – und dann geht.“ Es klingt fast lyrisch, wie er die Worte mit seiner tiefen, einfühlsamen Stimme pointiert betont vorträgt. Dabei tippt Heinz-Ulrich Nennen mit seinen Fingern gefühlvoll einige Töne in die Luft. Es scheint als dirigiere er seine Gedanken, es scheint als spiele er auf seinem Luftklavier die Melodie des münsterschen Hafenlebens.
Dabei mag man eine gewisse Sehnsucht nach Stille in seinen dunkelgrünen, stets offenen Augen erkennen. Aber Nennen ist keiner, der das Leben scheut. An diesem Tag kommt er gerade vom Hauptbahnhof. Er war den ganzen Tag über auf einer Philosophen-Tagung in Essen. Erst seit wenigen Minuten ist er „zuhause“. Er sitzt an seinem kleinen Schreibtisch. Den Fußboden unter ihm ziert echt anmutendes Buchen-Laminat. Zwischen den Fenstern hängen goldige Lampenhalter mit Faltschirmchen, daneben baumeln kleine Stoff-Gardinen und an den Wänden hängen Schränke in Eiche massiv. Ein bisschen US-geleiteter Biedermeier, ein wenig moderne Spätromantik oder doch deutsche Hochklassik? Der Einrichtungsstil ist nicht gleich klar.
„Die Wohnmobile werden von den Nachkommen der Indianer gebaut“, berichtet Nennen. „Eigentlich bin ich kein Eiche-Massiv-Typ. Ich stehe eher auf unterkühlte Moderne mit Selbstironie.“ Auch wenn die Inneneinrichtung durchaus anderes erahnen lässt, äußerlich hat Nennen offenbar das perfekte Heim gefunden: Der indianische Winnebago erinnert in seiner Form an amerikanische Kühlschränke. Diese klobigen, bunten oder metall-farbenen, rundlich-abgerundeten, quaderförmigen Exemplare, die nicht für die Montage in der gut bürgerlichen westfälischen Einbauküche geeignet sind. Sie müssen frei stehen. Und damit das Bild vollends perfekt ist, müssten Magnete an allen Seiten haften. Mit Notiz-Zettelchen, Fotos und Erinnerungen der schnelllebigen Welt dort draußen. Aber, so Nennen: „Entscheidend für den amerikanischen Automobilbau war die Eisenbahn und für diese wiederum der Schiffsbau. Dort hat sich das Auto nicht aus der Kutsche, sondern aus dem Waggonbau entwickelt. Daher ist die Spur, sind die Wagen breiter und größer als in Alt-Europa.“
Nennen kennt sein Gefährt – und er legt Wert auf eine gepflegte Erscheinung. Das ist das erste, was auffällt. Der Hafen-Philosoph trägt ausschließlich schwarz. Aus dem Ausschnitt des wolligen Knopf-Pullis suchen sich dunkle Brusthaare ihren Weg ans Tageslicht. Mit weit geöffneten Augen schaut er über seinen grau-melierten Vollbart hinweg. Auch in seinem dunklen Haar schimmern immer wieder hellere, manchmal dünnere, manchmal dickere Strähnen. Er kocht Tee und erzählt. Auf dem für ein Wohnmobil durchaus großen Tisch steht noch das letzte, nicht ganz ausgetrunkene Rotweinglas, direkt daneben die ausgebrannten Teelichter von vergangener Nacht. Es war eine der längeren Nächte. Die kommen häufiger vor.

Dann sitzt der Philosoph immer an seinem schwarzen IBM-Laptop und beobachtet durch die gut geputzten Fensterscheiben die Welt außerhalb seines mobilen Denkbüros. Schnell erkennt man: Nennen ist kein Camper. Auch nicht der Typ, der romantisch am Lagerfeuer grillt. Nennen ist vielmehr ein Feldforscher mit mobilem Wohnbüro – ausgestattet mit UMTS-Laptop, Satelliten-TV, Navigations-Touchscreen, Schlafzimmer, Dusche und eigenem Stromgenerator. Außer Spül- und Waschmaschine ist alles an Bord. Nennen: „Ich kann hier zehn Tage lang autark leben. Dann sind die Wasser‑, Gas- und Benzintanks leer.“
Aus diesen eigenen vier, sicheren und mobilen, Wänden beobachtet er in dunklen Nächten die Partygänger auf der anderen Uferseite des Kanalhafens. Er schaut, wie die Menschen an verschiedenen Wochentagen gehen oder wie sie in Gesprächen gestikulieren. Dann denkt er sich Geschichten dazu aus. „Die Menschen gehen jeden Tag anders“, berichtet er. „Am Sonntag flanieren sie gelassen an den Cafés und Kneipen vorbei. Sehen und gesehen werden – das ist wie auf der Promenade in Venedig.“ Wochentags hingegen sei der Gang hektischer. Die Leute seien dann gar nicht dort, wo sie gerade sind, sondern in Gedanken bereits sehr viel weiter. „Sie nehmen die Umgebung gar nicht richtig wahr, weil sie nur Distanzen überwinden. Das ist beim Flanieren ganz anders.“
Sein philosophisches Denkwerk hat Heinz-Ulrich Nennen an der Westfälischen-Wilhelms-Universität in Münster gelernt. Bereits im Teenager-Alter tauchte der gebürtige Rheinenser in der Domstadt auf, er ging hier zur Schule, studierte und promovierte vor knapp zwanzig Jahren an der philosophischen Fakultät. „Mit summa cum laude“, betont er nicht arrogant oder protzend, aber durchaus wissend. Wohl wissend und bedacht um den gesellschaftlichen Doktoren-Status, aber durchaus mit der Lebenserfahrung, dass ein „Dr.“ im Lebenslauf nicht allmächtig macht. Nach seiner Promotion dachte er, die Arbeitswelt reißt sich um ihn. Aber sie drehte sich auch ohne ihn weiter.
Die erste Zeit war er arbeitslos und auf der Suche. Dann unterrichtete er an der Dortmunder Fachhochschule für öffentliche Verwaltung angehende Polizisten in Ethik und forschte für zehn Jahre für die Stuttgarter Akademie für Technikfolgenabschätzung rund um die Auswirkungen der Atomkraft und des Klimawandels. Zwei Themen, die den gesellschaftspolitischen Diskurs bis heute prägen. „Sie waren bereits in den sechziger und siebziger Jahren ein brennendes philosophisches Thema“, erzählt Nennen. Schließlich habilitierte er über die Sloterdijk-Debatte: „Das war Philosophie in Echtzeit. Ich habe alles aus dem Moment heraus analysiert. Ein philosophischen Experiment, um zu zeigen, dass so etwas möglich ist.“
Dieses Prinzip hat er sich bis heute zu eigen gemacht. Es sind immer wieder kleine Momente und winzige Augenblicke des Alltags und deren Menschen, die ihn inspirieren. Sie sind ein kleiner Teil eines philosophischen Analyse-Patchworks. „Ich schreibe meine Vorlesungen jede Woche neu“, erklärt er. Es geht immer um das, was ihn gerade treibt – und um das, was sich um ihn herum in Münsters Hafen treibt. Wissenschaftlich ausgedrückt: „Empathie“, „Psyche“, „Selbstverständigung“, „Philosophie und Psychologie“ oder „Psychogenese“. Das sind die Bereiche, die Nennen in Forschung und Lehre der Karlsruher Uni hauptsächlich übernimmt.

Zwischendurch grüßen Spaziergänger und Hafenmeister. Die Leute hier kennen ihn – und er kennt sie. Aus dem Wohnmobil beobachtet er das Treiben, kommt ins Denken und findet den Stoff für seine Studenten. Nennen: „Der Hafen ist unberechenbar. Mal sind Schwimmer im Wasser, dann sind Triathlon-Wettbewerbe. Mal ist Hafenfest, dann legt die ‚MS Wissenschaft‘ an, um Baumstämme zu verladen. Mal setzt die Halle Münsterland stillgelegte Gleismaschinen für eine Ausstellung auf die alten Schienen, dann kommt plötzlich doch noch ein Güterzug.“ Dabei sind die Gleise neben dem alten Hafenkran seit Jahren längst verwaist. Als grün verwachsene, rostig-rötliche Linien ziehen sie sich unter Nennens Wohnmobil her. Sie führen die Spaziergänger und ihre Hunde und weisen ihnen einen geradlinigen, parallelen Weg zum welligen Wasser im Hafenbecken.
Es ist wohl die Abwechslung, das ständig Neue, was der Philosoph braucht. Vor allem ist es aber das Unvorhersehbare und das Unvorhergesehene. Das scheint ihn in seiner Philosophie anzutreiben. Dazu gehört auch der gewohnte, aber nicht zwangsläufi g gleichmäßige Takt der Tanzjünger im „Heaven“, einem Szeneclub, der einige Dutzend Meter Luftlinie entfernt am anderen Ufer des Kanals liegt. Wenn Nennen am Wochenende oder nach Münsters studentischem Partymittwoch spät nachts in seinem Denkbüro hockt, hört er wie sie den Beat zur frühen Tagesstunde erhöhen. Unwillkürlich denkt er an Kinder von Fließbandarbeitern: „Dieser Sound wirkt, als suchten sie das Band als Lebensrhythmus. Um drei Uhr wird immer der Arbeitstakt erhöht.“
Allerdings nicht nur bei den Tänzern – auch im Wohnmobil: „Ich brauche den Rummel um mich herum. Der inspiriert mich“, bestätigt Nennen. Nachdenklich stützt er den Kopf auf die Hand. Irgendwann ist es dann wieder fünf Uhr, dann ist es sechs. Er schaut aus dem kleinen Fenster seines Winnebagos. Irgendwann kehrt Ruhe ein, dann bringt die erste Welle das Leben zurück. Heinz-Ulrich Nennen krault durch seinen ergrauten Bart. Sie kommt, läuft vorbei, kehrt vom anderen Ende wieder zurück. Sie kommt, sie geht und haucht dem kleinen Hafenkosmos Leben ein. Nennen trinkt einen Schluck Tee. Da ist sie, die nächste Idee.

Es ist nicht ganz zwölf Monate später. Diesmal verabreden wir uns am anderen Ufer des Hafens gegenüber von Nennens Wohnmobil. Besser gesagt: gegenüber vom gewohnten Platz des Winnebagos. Denn der steht an diesem Tag nicht dort. Nennen hat an diesem Tag im nahen Fuestrup am Kanalübergang einen anderen Hafen für sein Denkbüro gefunden. Dieser kleiner Umstand hält ihn allerdings keineswegs vom Denken ab. Ganz im Gegenteil.
An einem Geländer schließt Heinz-Ulrich Nennen sein gemütliches Fahrrad ab. Der Rahmen hat eine äußerst außergewöhnliche Form. Das elegant, leichte Modell erinnert an Omas altes Hollandrad, aber irgendwie hat es auch etwas von einem dieser modernen Cruiser-Bikes. Der Rahmen aus geradem, schwarzen Rohr ist mehrfach verstrebt. Seine Winkel bilden die Silhouette eines schwebenden Drachens, der während der Fahrt zügig und knapp über den Boden fliegt. „Dieses Modell ist bereits Ende des neunzehnten Jahrhunderts gebaut worden“, erklärt Nennen. Das gilt zwar nicht für sein Exemplar, aber zumindest für das Patent: „Das Pedersen ist ein um 1890 von dem Dänen Mikael Pedersen entwickeltes Rad, das drei Jahre später zum Patent angemeldet und später in Christiania, einer alternativen Wohnsiedlung in Kopenhagen, wiederentdeckt wurde. Man hat damals überlegt, ob es möglich ist, Fahrräder aus Bambus zu bauen, was fast funktioniert hätte.“
Auch bei diesem seiner Verkehrsmittel weiß Nennen um die Historie. Der Winnebago als indianisches, großräumiges Lebensdomizil und eine dänische, geschichtsträchtige Leeze – für Philosoph Nennen sind sie nicht nur Gebrauchs‑, sondern auch Luxusgegenstände. Sie unterscheiden den landstreichenden Globetrotter, den grillenden Lampion-Camper und Heinz-Ulrich Nennen einmal mehr ganz deutlich voneinander. Gekleidet ist er wie beim ersten Treffen: Wieder trägt er einen schwarzen, eleganten Wollpulli zu einem dezent gestreiften Sakko. Der Bart sieht nicht bedeutend grauer aus, die Haare auch nicht. Nennen schreitet über die alten Güterschienen, die ihn geradeaus mit Blick in Richtung der bunten Leuchtreklame des Kinos führen.
„Wir sind sehr mächtig im Kulissenschieben“, murmelt er durch seinen Vollbart. „Es sind unscheinbare Augenblicke, die wir schnell übersehen. Augenblicke, die eine entscheidende Weiche im Leben stellen. Besonders spannend sind Irrtümer“, sagt der Philosoph. „Wir irren uns in Momenten, die wir uns gar nicht bewusst machen, und bauen darauf unser komplettes Leben auf. Wir bauen unsere Bühne so, wie wir es wollen. Das birgt eine gewaltige Gefahr.“ Wer führt da Regie? Nennen hält kurz inne und überlegt. Etwa wir selbst? Das ganze Leben ein Theater? „Aber es eröffnet zugleich eine riesige Chance“, fährt er fort. Allerdings unter einer sehr entscheidenden, wenn nicht notwendigen Bedingung: „Wir müssen unsere Souveränität behalten! Nur dann kann man sagen: Es sind meine ganz persönlichen Erfahrungen, die ich mache, nicht irgendwelche. Ich lass’ das jetzt erst mal so laufen – und schaue einfach mal zu, was mit mir passiert.“
Man merkt schnell, was er bereits vor diesem Gespräch angekündigt hat: Heinz-Ulrich Nennen hat sein philosophisches Schaffen in Münster ausgeweitet. Er arbeitet hier nun auch als lebensphilosophischer Wegweiser. Das einstige Phantom des Industriehafens ist zu einem Ratgeber in Münsters alltagsphilosophischer Oper geworden. Denn Nennen hat im vergangenen Jahr ein neues Betätigungs- und Denkfeld entdeckt. Er lädt inzwischen gemeinsam mit der Volkshochschule zum sonntäglichen „Philosophischen Café“ und zieht als „ambulanter Philosoph“ durch die westfälische Domstadt. Soll heißen: Der Philosoph kommt zu Besuch oder man kann ihn besuchen – in seinem amerikanischen Winnebago-Wohnmobil.
In einem benachbarten Café bestellt er einen Prosecco und plaudert. „Ich will den Menschen gedankliche Impulse mit auf den Weg geben und das Denken über das eigene Denken und Tun fördern“, erklärt er. Die Terminvereinbarung laufe modern per E‑Mail und an Ambulanz möge er die „Ironie des Notdürftigen”. Denn die Philosophie sei gar nicht so akademisch, wie viele Menschen denken. „Sie ist in ihren Ursprüngen vor allem eine Lebenskunst, die auch mit Heiterkeit zu tun hat und die uns zum Schmunzeln bringt. Erkenntnis muss doch nicht weh tun. Gerade Selbsterkenntnis sollte bereichern!“ Der ambulante Philosoph selbst habe bereits in seiner revolutionär-aufmüpfigen Zeit der Pubertät angefangen, übers Denken nachzudenken. „Ich habe angefangen, in Eventualitäten zu denken”, erklärt er. Er habe damals wie viele seiner Zeitgenossen mit seiner Vorstellung von gesellschaftlichen Idealen und moralischen Regeln nicht in dieses System und diese Welt gepasst.
Als er als Teenager nach Münster kam, hauste er zunächst in einer Wohngemeinschaft. Später mietete er sich ein altes Bauernhaus in Ascheberg – rund fünfundzwanzig Kilometer entfernt der Domstadt. Nennen: „Das musste damals einfach sein!” Schließlich war es die Zeit der ländlichen Kommunen, Aussteiger und Selbstversorger. Nennen selbst war für hundertfünfzig Deutsche Mark Miete allerdings ganz bewusst allein zu Haus. Möglichst viel lesen, meditieren und diskutieren stand auf dem Programm. Wenn der kleine Kotten im Winter eingeschneit war, holte er sich seine Post auch schon mal aus einem Baum an der Straße. Nennen: „Ganz wichtig war die tägliche Berliner Tageszeitung. Die war damals ein Muss!” Nur im tiefsten Winter zog es ihn von seinem kleinen Selbstversorger-Hof in das münsterländische Domzentrum: „Wenn die Toiletten zugefroren waren, dann hatte man verloren und musste in die Stadt.”
Heinz-Ulrich Nennen spielt mit einer goldenen Flieger-Sonnenbrille, die er auf dem Tisch vor sich plaziert hat. Nach der Zeit des „programmatischen Aussteigertums” habe er dann den Weg in „diese Welt” gesucht, fährt er fort: „Weg von den magisch-mystischen Weltanschauungen der Hippie-Generation.” Mit seiner Hand vertreibt er immer wieder die Fliegen vom süßen Kaffee des Interviewers. Die eine oder andere Droge habe er damals probiert. „Nicht zum wegschädeln, sondern zur Bewusstseinserweiterung”, betont er in gelassenem Tonfall, aber durchaus mit einem stimmlich erhobenen Zeigefinger. Man könne schließlich nur solange gesund philosophieren, wie man nicht psychotische Züge annimmt und aus der eigenen Umgebung und Wirklichkeit davon fliegt. So hat er irgendwann in Büchern die Welt und in der Welt wiederum vieles an Philosophie entdeckt. Denn Philosophieren ist eine Frage der Perspektiven.

So hat er sich gesetzten Alters offenbar gut mit dieser Welt arrangiert – möglicherweise gar versöhnt: „Wir können uns aus vielen verschiedenen Kameraperspektiven betrachten. Der gesellschaftliche Diskurs betont immer wieder, dass wir einstimmig sein sollen. Dabei besitzt jeder Mensch doch so mannigfaltige Perspektiven auf sich selbst, dass er auch unterschiedlichen Stimmen folgen kann.” Da komme es darauf an, „Herr der eigenen Vielfalt” zu sein. Das bedeute nicht, sich an vagen Lianen durch den sozialen Großstadtdschungel zu hangeln, sondern vielmehr, die richtige Liane zu suchen, bevor man auf die weitere Lebensreise geht. Nennen: „Wir sollten in jeder Situation ganz genau ausloten, welcher Stimme wir bewusst folgen wollen. Zunächst kommt es aber darauf an, alle diese Stimmen wirklich zu vernehmen.”
Das bewusstseinserweiternde Hilfsmittel der Drogen war ihm dabei immer schon suspekt. Das gleiche gilt sowohl für die Schulmedizin, als auch die Arbeit mit Patienten, Klienten oder Kranken. So ist Nennen bewusst nicht Heilpraktiker geworden. Als ambulanter Philosoph will er nicht heilen, sondern der eigenen Souveränität zum Auftrieb verhelfen. „Im inspirierenden Dialog“, betont er. Er habe die Drogen bewusst für sein Bewusstsein eingesetzt. Aber er habe immer darüber nachgedacht, wie sie ihn ihrerseits beeinflussen, ihn hinters Licht führen und an seinen Strippen ziehen, um ihn möglicherweise aufs Kreuz zu legen. „Viele Menschen handeln wie Marionetten, die sich in Erwartungen und Idealen verwickelt haben”, gibt er zu bedenken. Weil sie nicht über ihr Denken nachdenken, seien viele Mitmenschen verstrickt und gefangen in Erwartungen, Idealen und sozialen Netzen, die sich häufig als verfehlt herausstellen, sobald das Denken darüber in Gang kommt.
Das Gespräch hat gar etwas von einem Besuch beim Psycho-Doc. Oder ist es eine typische Seminarsituation, wie Nennen sie regelmäßig mit seinen Studenten teilt? Die Wahrheit bewegt sich wohl irgendwo dazwischen. Ganz trennscharf sind die Linien zwischen Philosophie und Psychologie ohnehin nicht immer, gibt auch der Philosoph zu. Der Unterschied zwischen beiden ist wohl der Grad an Freiheit. Ein Psychologe behandle eher Störungen, die einen Menschen in seinem Leben einschränken, differenziert Nennen. Als ambulanter Philosoph hingegen will er im Menschen selbst das Hand- und Denkwerkzeug wecken, sich in seiner sozialen Umwelt zu finden und zu verorten: „Das ist Selbstprogrammierung”, sagt Nennen. „Philosophieren kostet Zeit. Wer es ausgelassen tut, entlastet sich nicht, sondern belastet sich zusätzlich.” Denn die Philosophie beherberge weniger konkrete Antworten als immer mehr Fragen, die man an sich selbst, sein Leben und die Gesellschaft stellen kann. Nennen: „Daher braucht es den Philosophen als Ratgeber in diesen Fragen. Wie einen Pfadfinder, der Wege kennt, die durch das Dickicht der Gedanken, Ideale und Gefühle hindurch führt.”
So müssen seine Gesprächspartner auch die Kosten für die einstündige Winnebago-Denkerrunde von fünfzig Euro selbst bezahlen. Einen Psychologen zahlt im Regelfall die Krankenkasse. Davon, dass das deutsche Gesundheitssystem auch die philosophische „Orientierung zur Selbstorientierung”, wie Nennen sie nennt, bezahlt, sind wir wohl noch ein Stückchen entfernt. Der gesellschaftliche Trend zum Nachdenken übers Denken sei Jahrtausende nach Platon allerdings wieder auf dem Weg zurück ins allgemeine Bewusstsein, stellt er fest: „Warum bekommt Richard David Precht sonst eine eigene Fernsehsendung?” Die Philosophie scheint gerade in der Krise und in einer Übergangszeit an Bedeutung zu gewinnen. Denn gerade dann suchen die Menschen nach etwas Neuem, woran sie sich festhalten können. Dabei sollten sie doch viel besser darüber nachdenken, wie sie sich selbst vor allem auch von neuen Seiten kennen lernen und selbst orientieren können, mahnt Nennen.
Nur allzuoft sieht der ambulante Philosoph unsere Ideale mehr als nur zwiespältig. „Ich habe den begründeten Verdacht, viele unsere Ideale könnten gar falsch sein”, streut er auf einmal und ein wenig plötzlich ein. „Wir treffen Entscheidungen ohne darüber nachzudenken, was wir uns dabei gedacht haben. Wir spielen Rollen, ohne zu wissen, warum wir sie so und nicht anders spielen. Und das Schlimmste ist: Die meisten Menschen glauben, sie wüßten, was sie denken und tun!” Kurzum: Wir machen fremde Ideale zu unseren eigenen – ohne zu wissen, warum. Einfach so. Ohne jemals darüber nachgedacht zu haben. Es ist die soziale Entfremdung und postmoderne Fragmentisierung, die der Philosoph beklagt.
Das Leben gestaltet sich zunehmend komplexer. Es ist soviel da, aber alles nur bruchstückhaft. Die Zivilisation und Verstädterung habe die Menschen zu versprengten, zersplitterten Individuen gemacht, sagt Nennen. Bei allen positiven Facetten der Individulität handelten die Menschen allerdings bei weitem noch nicht genügend selbständig und aus sich selbst heraus. Denn gerade das ist eine nicht immer wohlschmeckende Pille – vor allem für die, die in der Lage sind, souverän zu denken.
Heinz-Ulrich Nennen ist ein Freidenker. Er vergleicht die Philosophie gerne mit einer freischwebenden Feder: „Ziel des Philosophierens ist es, die Feder stets in der Schwebe zu halten.” Sie darf nicht herunterfallen, aber sie darf sich auch nicht mit dem nächsten Windstoß so einfach verabschieden. Nennen denkt bei diesem Bild insbesondere an die Ur-Philosophie eines Platon: Solange alles in der Schwebe bleibt, ist der philosophische Diskurs, der eigene Geist und damit auch das eigene Leben in Bewegung. Allerdings offenbart die Schwebe-Philosophie – nicht zuletzt in Person eines Friedrich Nietzsche – gewiss auch ein enormes Absturzpotential. Ständig das eigene, im unendlichen Raum schwebende Selbst zu suchen und zu finden, kann auch eine ewige Jagd zwischen Hase und Igel sein. Philosophie kann federleicht beflügeln, aber sie kann auch schwermütig fesseln – bis zum Exzess.
Gerade in Zeiten einer allgemeinen sozialen Verunsicherung ist der Schwebezustand logischerweise besonders prekär. Menschen brauchen Orientierung. Viele Jahrhunderte lang waren die Kirche und der Glaube an Gott dafür zuständig. Es gibt Götter, sie verkörpern unsere Ideale aber auch unsere Ängste, das steht auch für den Philosophen außer Frage. Nennen: „Sie waren und sind seit Jahrtausenden das, wonach die Menschen streben.“ In Zeiten, in denen es Religion und Kirche schwer haben, übernehmen allerdings zunehmend andere deren Aufgabe. Michael Jackson etwa. Nennen meint Idole, an denen sich die Menschen ausrichten – ohne dass diese Idole noch echte Menschen wären. Denn sie sind lediglich Bilder, ein „Imago”, wie Nennen sagt. Sie bilden das populäre Image als vermenschlichten Lebensgeist ab.
Bis zur Selbst-Aufgabe habe der „King of Pop” den Menschen etwas darbieten wollen. „Dabei hätte es doch gereicht, wenn er einfach nur dagewesen wäre”, bedauert Nennen. „Jackson musste kaum mehr etwas dafür tun, dass die Massen außer sich gerieten.” So habe er ein Konzert durch minutenlanges Stillstehen begonnen, worauf die Fans jede noch so geringe ruckartige Bewegung frenetisch feierten. „Auch bei der neuen Tournee hätten die Fans ihn vergöttert”, denkt Nennen. Aber Jackson habe zu viel gewollt: „Er wollte besser sein als Michael Jackson und hat damit den gleichen Fehler gemacht wie Nietzsche.” Während der Popstar im Alter von einundfünfzig Jahren an einer Überdosis von Schmerzmitteln starb, hielt es Philosoph Nietzsche zwar noch eine Handvoll Jahre länger aus. Aber auch er stürzte ab.
Er habe seine Feder zu hoch fliegen lassen, sagt Nennen, sich daraus sehr vage Flügel gebaut. Er hätte sich am Rat seines Vaters Daedalus orientieren sollen, stets in der Mitte zwischen dem kalten Meer und der heißen Sonne zu fliegen. Aber er sollte bekanntlich der Sonne zu nahe kommen und mit gebrochenen Flügeln abstürzen. Er ist zu lange zu hoch geflogen, um die göttliche Sonne seines eigenen Selbst zu suchen. Dann aber sind die gewachsten Tragflächen seiner Seele verbrannt. Er starb schließlich im Alter von sechsundfünfzig Jahren. „Irgendwann löst sich bei den Stars unserer Tage das prominente Götterbild ab und beginnt ein Eigenleben zu führen”, erläutert Philosoph Nennen. „Da kommt es auf den Charakter hinter der Kunstfigur kaum mehr an. Die Leute wollen den Menschen dahinter gar nicht mehr sehen. Sie kennen ihn schließlich überhaupt nicht, sondern spiegeln lediglich ihre eigenen Ideale auf ein unerreichbares Bild.”
Sie verehrten anstelle dessen ein kunterbuntes Potpourri ihrer eigenen Gefühle und Sehnsüchte, wie sie etwa in einem Gott Jackson deutlich intensiver zu Tage treten, als sie es jemals in der Person hinter der Pop-Ikone könnten. Daher werde in den Regenbogenmedien so gern der so genannte „Mensch dahinter” inszeniert, was den Widerspruch nur noch weiter verschärfe. So stellt Nennen fest: „Götter müssen sich nicht rechtfertigen. Wir aber müssen das.” Dabei sei doch jeder Irrtum das Größte, das man an und in sich entdecken kann: „Gerade der Unterschied zwischen Mensch und Gott ist das, worauf es ankommt. Wenn ein Irrtum auffliegt, lachen wir doch sehr oft auch. Dann sind wir fröhlich – und sogar überaus glücklich.” Kein Irrtum sei es wert, sich darüber zu ärgern. Man sollte nur erkennen und darum wissen, dass man eine „systematisch falsche Methode” benutzt hat. Anderes Denkinstrument – neue Chance. Was für Nennen zählt, ist der „ergebnisoffene Weg” – nicht eine voreilige Entscheidung oder ein vorschnelles Urteil.
Heinz-Ulrich Nennen schaut aus dem großen Fenster des Cafès auf das wellige Wasser des Kanals und die alten, verwaisten Bahnschienen, die davor durchs wild gewachsene Gras schimmern. „Wenn wir die Weiche finden, vor der wir noch alle Optionen hatten, können wir nur daraus lernen”, sagt er. Dann verabschiedet er sich für diesen Tag. Der ambulante Philosoph hat noch einen Termin. Er krault noch einmal durch seinen Bart, steigt auf sein gemütliches Pedersen-Drachenrad und fährt über die holprigen alten Waschbetonplatten davon. Aber schon bald, kommt er wieder. Das ist sicher. Zum Denken übers Denken in seinem indianischen Winnebago.
Dr. Heinz-Ulrich Nennen
Bis 1989 studierte Heinz-Ulrich Nennen Philosophie, Soziologie und Erziehungswissenschaften an der Uni Münster. Er promovierte über „Ökologie im Diskurs“, habilitierte 2003 über die „Sloterdijk-Debatte“ und arbeitet nun als Hochschullehrer an der Uni Karlsruhe. Zuhause aber fühlt er sich noch immer in Münster.

Walter Crane: Die Rosse des Neptun. Neue Pinakothek München, Public Domain @ Wikimedia
Die Götter der Antike sind wie die Stars unserer Tage, die Sterne von damals sind die Sternchen von heute. Alle ihre einzelnen Fähigkeiten, mit denen sie sich im Verlaufe der Zeit angereichert haben, lassen sich oft noch an den vielen Beinamen erkennen, es sind Spuren vereinnahmter Häuptlingstümer, es sind die Geister von Clans, Landschaften und Kulturen, die längst aufgegangen sind im größeren Ganzen dieser Göttergestalten. Gerade Götter verfügen über multiple Identitäten, daher fällt es ihnen so leicht, in fremder Gestalt aufzutreten, um sich selbst dabei doch treu zu bleiben. Daher beherrschen sie das Spiel mit den Masken. Besonders Zeus wechselt ein ums andere Mal für Liebesabenteuer äußerst spektakulär die eigene Gestalt: Er nähert sich seiner späteren Gattin Hera als durchnäßter, zitternder Kuckuck, als Stier der Europa, als Schwan der Leda, als goldener Regen der Danaë und um den Herakles zu zeugen, verwandelt er sich in Amphitryon, den Gatten der Alkmene.
Götter wie Zeus beherrschen einfach dieses bedeutende Kunststück, sich auch in fremder Gestalt noch immer selbst treu zu bleiben. Im Prozeß der Zivilisation wird nicht nur die Außenwelt, sondern auch die Innenwelt immer weiter ausdifferenziert. Mit der Zivilisation, Rationalität und Moderne geht daher stets auch ein Prozeß der Psychogenese einher. Götter haben uns dabei stets etwas voraus, sie verkörpern die Ideale, auf die es ankommt. Dementsprechend läßt sich anhand der außerordentlichen Fähigkeiten von Götter die Zukunft der Psyche ablesen. Das nunmehr im Zuge der Psychogenese anstehende multiple Selbst wird seinerseits über diese entscheidende göttliche Fähigkeit verfügen, sich anverwandeln zu können.
Die klassischen Einwände dagegen, das sei keine Wahrhaftigkeit mehr, sondern eben Inszenierung, es sei keine Authentizität, sondern nur Vorspiegelung im Spiele, können nicht mehr verfangen. Wir haben nicht eine einzig wahre Natur, das einzig verbindliche Selbst oder irgendeine fixierte Identität in uns, die ehrlichkeitshalber nur zum Ausdruck gebracht werden muß, während alles andere nur Lug und Trug sein würde. Die Frage nach der Wahrhaftigkeit eines Gottes, der eine Metamorphose vollzogen hat, ist unangebracht, es kommt darauf an, was sich in der Wahrnehmung ereignet. Entscheidend ist das Erleben, etwa einem Schauspieler abnehmen zu können, was er vorgibt zu sein.
Wir alle spielen Theater, was eben nicht bedeutet, daß es uns nicht ernst damit wäre. Das Maskenspiel ist dabei mehr als nur eine ausgezeichnete Metaphorik für das, was sich da eigentlich ereignet, es ist der Bruch mit der naiven Erwartung, daß wir immer dieselben sind und es auch bleiben. Wer eine Maske aufsetzt, übernimmt eine Rolle, wird somit zu jemand Anderen, wechselt also die Identität.
[gview file=„https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Anthropologie-der-modernen-Welt.pdf”]
![Gustave Moreau [Public domain], via Wikimedia Commons](https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Oedipus_and_the_Sphinx_1864.jpg)
Gustave Moreau [Public domain], via Wikimedia Commons
Die Plots ausnehmend vieler Märchen und Mythen ranken sich immer wieder um absonderliche Gestalten und Figuren, um seltsame Wesen. Nicht selten sind es Monster, deren Existenz äußerst problematisch ist. Oft sind sie entstellt, der Zugang zu ihrer eigenen Natur ist ihnen genommen. Eigentlich dürften sie gar nicht sein, aber es ist etwas Ungeheuerliches vorgefallen.
Ein Fluch, ein böser Zauber liegt über dem ganzen Land und läßt sich einfach nicht lösen. Irgend etwas hat dieses Monster auf den Plan gerufen, das Ungeheure ist nicht einfach nur da. Es taucht nicht einfach nur auf, sondern ist selbst verursacht. Und nun gehen von Stund an ganz erhebliche Wirkungen davon aus. Nichts kann so bleiben wie es ist, aber nichts läßt sich ändern. Die Lage ist aussichtslos, zu viele haben es bereits versucht, sind kläglich gescheitert und haben dabei ihr Leben verloren.
Es ist bemerkenswert, wie erstaunlich anschlußfähig märchenhafte Ungeheuer und mythische Monster eigentlich sind. Sie sind nicht selten unglücklich über sich selbst. Aber der Zauber einer Untat hat Macht über sie, hat sie ins Leben, in die Wirklichkeit gerufen, hat ihnen zu erscheinen befohlen und nun sind sie da, ebenso ungeheuerlich wie berechenbar, nachfühlbar, in ihrer Existenz nachvollziehbar, wenn man ihnen nur Gelegenheit bietet, zu sagen, was es mit ihnen auf sich hat. – Das Monster betritt die Bühne stets in dem Augenblick, von dem ab die Handlung ihren unumkehrbaren Verlauf nehmen wird, alles läuft zunächst auf die Konstellation absoluter Ausweglosigkeit hinaus. Der Schlaf der Vernunft gebiert diese Ungeheuer.
Nicht selten sind lebensnotwendige Ressourcen bedroht: Ein Zauberbaum trägt keine Früchte mehr, ein lebensnotwendiger Brunnen liefert kein Wasser oder ist vergiftet. Ein Fluch liegt über dem ganzen Land, das Unheil nimmt nun seinen Lauf, es ist nicht mehr abzuwenden, es wird sich erfüllen. Jede Bewegung führt nur noch tiefer in die Verstrickung hinein, dem Schicksal entgegen, wie bei Ödipus.—Es ist kein Ausweg möglich, jedenfalls nicht für die, die unmittelbar betroffen sind. Sie können sich selbst nicht mehr helfen, sie müssen sich behelfen,sie werden im Zweifel alles opfern müssen, und schlußendlichwird ihnen nichts mehr bleiben, als sich vollkommen resigniertins schlimme Schicksal zu fügen, aber auch das ist mehr als unerträglich.
Viele dieser Monster lassen sich psychologisch deuten, denn sie befinden sich stets an einer Schlüsselstelle, sie stehen an einer engen Passage, immer dort, wo das Leben, insbesondere der Held vorbeikommen muß. Sie versperren den weiteren Weg, weitere Entwicklung, bald wird es nicht mehr voran und auch nicht mehr zurück gehen, sie machen das Leben zusehens unerträglich. Und in der Tat ist die ganze Konstellation unnatürlich,ja widernatürlich, weil die natürlichen Entwicklungsprozessenicht nur behindert, sondern vollkommen ad absurdum geführtwerden.
Ungeheuer haben etwas von jener Epiphanie, die auch für Geister, Dämonen und Götter typisch ist. Aber Götter geben einer vollkommen verfahrenen Konstellation dem Ganzen zumeist eine glückliche Wendung, sie weisen den Ausweg, Monster blockieren dagegen in der Regel nur die weitere Entwicklung. Sie verkörpern das, was im Wege steht und fungieren dabei wie Indikatoren. Sie demonstrieren mit ihrem Auftreten eindeutig, ultimativ und unwiderruflich, daß etwas Ungeheuerliches vorgefallen sein muß, etwas, das nicht nur die soziale sondern auch die transzendentale Ordnung erschüttert und aus dem Gleichgewicht gebracht hat, etwas, das Sühne verlangt.
Märchenhafte Monster sind wie Manifestationen von Entwicklungsstörungen, die so hartnäckig sind wie der Zauber eines bösen Fluchs, der über allem lastet. So steht dann das Ungeheuer der notwendigen weiteren Entwicklung im Wege, es verhindert das Business as usual einfach fortzusetzen. Das Ungeheuer erzwingt die Auseinandersetzung, die Wiederkehr des Verdrängten. Die Natur der Ungeheuer ist das Trauma, das sie verkörpern müssen. Seltsamerweise sind sie oft melancholisch, ja geradezu lebensmüde. Und zum Helden, der sie doch vom Leben zum Tode befördern wird, haben sie ein erstaunlich ambivalentes Verhältnis …
[gview file=„https://nennen-online.de/wp-content/uploads/Nennen-Psychologie-in-Mythen-und-Maerchen-V-SS13.pdf” save=„1”]
Münster – Unter einem grünen Schirm, zwischen Birkenstämmen, sitzt der Philosoph am Dortmund-Ems-Kanal und tippt in sein Notebook. (…) Warum er in Münster am Kanal arbeitet, in einem Heim auf Rollen? „Na“, antwortet der Mann, der in Rheine geboren ist, und schiebt sich eine silbrige Locke hinters Ohr, „weil Münster meine Heimat ist und ich ein geistiger Nomade. Ich brauche ständig Perspektivwechsel.“ Sesshaftigkeit ist nichts für einen wie ihn, der am Kanal „geduldet ist“ („man kennt mich hier“) und in Karlsruhe im Hotel übernachtet. Mit dem Winnebago dorthin zu fahren, das hat er schnell drangegeben. „35 Liter Super schluckt der, und es kostet Nerven, ihn zu fahren“, verrät Nennen und schickt ein belustigtes Blitzen aus Bernstein-Augen hinterher. Fährt er mit dem Wagen durch die Straßen, bleiben die Leute am Rand stehen und lachen. „Das ist einfach ein Ungetüm.“ Teil seiner philosophischen Existenz, sei der Winnebago eine Art Selbstversuch. Anders als Diogenes in der Tonne ist der 60-Jährige jedoch mit der Zeit gegangen – immerhin hat der Wagen Dusche und Klimaanlage.
Und so sitzt Heinz-Ulrich Nennen heute im Windschatten des Ungetüms, Birkenpollen im Haar und kleine Gewitterfliegen auf den Schultern, und bereitet seine Vorlesungen vor. An der „Grenze zwischen Psychologie, Anthropologie, Kulturwissenschaft und Philosophie“ geht er der „Erschöpfung des Selbst“ auf die Spur und arbeitet heraus: Was ist das genau, ein Burnout? Und wie entstehen Depressionen? Dafür dokumentiert er, was in den Köpfen der Menschen heute so vorgeht. Beleuchtet den krankmachenden Drang, sich für alles verantwortlich zu fühlen. (…)
In den Semesterferien soll Nennens neues Buch erscheinen. „Die Masken der Götter“, sagt er, sei ein Stück Psychologie auf der Grundlage von Göttergeschichten. Experten in Liebes- und Kriegsangelegenheiten, seien alle Gottheiten schon immer unsere Projektionen gewesen. „Und weil sie das sind, sind sie nicht nichts.“
Ein heller Kopf, der Mann am Kanal, der dort eine eigene „Philosophische Ambulanz“ betreibt. Der Begriff sei ein Gag, räumt er ein, sein Anliegen jedoch ernst gemeint. Wer zu ihm kommt, dem hilft er, „durch Erwägen neue Einsichten zu gewinnen“. Philosophie als Seelenheilkunde also, Beratung zur Selbstberatung – „für alle Zweifelsfälle des Lebens, des Denkens und nicht zuletzt des Fühlens“.
[instagram-feed]
Copyright © 2010-2025 Heinz-Ulrich Nennen
