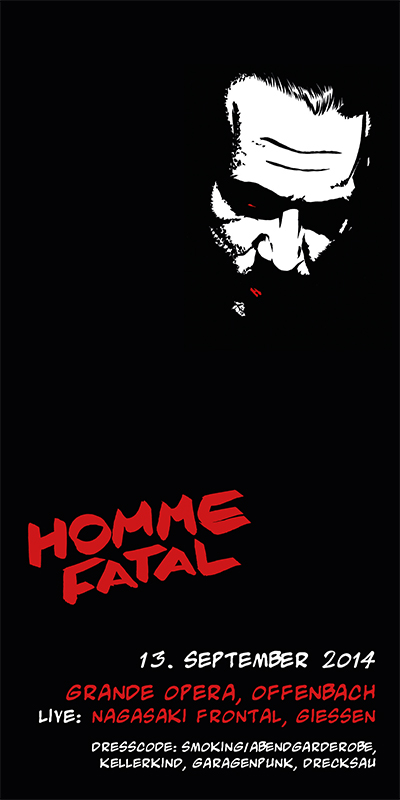Nur wer die Sehnsucht kennt

Goethe Lotte Werther. Stadt– und Industriemuseum, Wetzlar 2014.—Quelle: 3StepsCrew, Giessen, Germany via Wikimedia, Lizenz: CC-BY-SA‑2.0.
Mit seinem Werther trifft Goethe das epochale Lebensgefühl junger Leute im Spannungsfeld zwischen der neuen Empfindsamkeit und einer überkommenen Moral, die eigentlich alles Persönliche im Keim erstickte. Dagegen gründete sich die seinerzeit als Lesesucht bezeichnete Suche nach den Motiven einer neuen Sehnsucht auf Individualität und auch auf Narzissmus. So entstand der neue Zeitgeist mit einem Hang zum sentimentalischen Charakter, der erst in der Romantik ganz zum Ausdruck kommen und auch seine Schattenseiten entwickeln sollte.
Das neu heranbrausende Zeitalter der Empfindsamkeit war selbstverständlich höchst umstritten, denn damit wurde ein ganz bedeutender Schub in der Psychogenese ausgelöst. Anstelle der stets so tugendhaft und alternativlos hingestellten Fügsamkeit, sich den Anforderungen eines überkommenen Konventionalismus klaglos zu überantworten, wurde nun der Ausdruck eines neuen Individualismus möglich, der Weltschmerz und Melancholie zum Ausdruck brachte und dabei bis zum Narzissmus führen konnte.—Die Figur des Werther war dabei der Prototyp eines neuen Zeitgenossen, der mit seiner unstillbaren Sehnsucht, seinem überbordendem Narzissmus und mit seiner Melancholie an der herrschenden Moral einfach scheitert.
Das war eine, wenn nicht die erste ›Jugendbewegung‹. Weitere Reaktionen in Kunst und Literatur ließen nicht auf sich warten. Massive Veränderungen im Selbstverständnis und im Selbstverhältnis gingen damit einher. Es kam zur Vorbildfunktion, zur Identifikation, zur Nachahmung der Hauptfigur und schließlich zum Werther–Kult mit einer Reihe von Suiziden oder Suizidversuchen.—Das war nicht nur ein Bruch mit der Tradition der Fremdbestimmung, sondern eine Demonstration des Anspruchs auf Individualität jenseits der herkömmlichen Moral. Und so wurde dann auch der Selbstmord dieses tragischen Helden nicht mehr als Sünde tabuisiert, sondern als ›Freytod‹ betrachtet, als Ausdruck einer individuellen Freiheit, sich gegen gesellschaftliche Zwänge zu behaupten, indem man sich dem Weiterleben ›entzieht‹.
Im Wilhelm Meister wird diese träumende Sehnsucht weiter zum Ausdruck gebracht, aber auch eine Naivität, die zustande kommt, wo Empathie ohne Theorie einfach nur auf eine neue Sehnsucht zielt, von der nicht inhaltlich gesagt werden kann, was denn nun die Sehnsucht dieser Sehnsucht sein soll:
Er verfiel in eine träumende Sehnsucht, und wie einstimmend mit
seinen Empfindungen war das Lied, das eben in dieser Stunde Mi-
gnon und der Harfner als ein unregelmäßiges Duett mit dem herz-
lichsten Ausdrucke sangen:Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh’ ich ans Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!(Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters Lehrjahre.
In: Hamburger Ausgabe, Hamburg 1977ff. Bd. 7. S. 240f.)
So träumt dann Wilhelm Meister noch in träumender Sehnsucht, kommt aber aus dem Leiden am Leiden nicht heraus. Es bleibt bei der Sehnsucht nach dem, was der Sehnsucht wert ist. Und so geht Goethes Faust weit darüber hinaus: Er greift wirklich nach den Sternen und macht dabei diejenigen Welt– und Selbst–Erfahrungen, die dazu angetan sind, für sich selbst besser wahrnehmen zu können, was denn gewollt werden sollte.
Faust ist rastlos, unerfüllt, umtriebig und voller Sehnsucht nach einer Sehnsucht, deren Beweggründe ihm selbst aber unbekannt sind. Er täuscht sich darüber, was und wo denn nun das Land seiner Träume liegt, was das Ziel aller Sehsüchte sein soll.—Im Dialog mit der Sorge, die sehr melancholische Züge trägt, erläutert er die zunehmende Ruhe der Weisheit, die mit der Erfahrenheit einhergeht:
FAUST.
Ich bin nur durch die Welt gerannt;
Ein jed’ Gelüst ergriff ich bei den Haaren,
Was nicht genügte, ließ ich fahren,
Was mir entwischte, ließ ich ziehn.
Ich habe nur begehrt und nur vollbracht
Und abermals gewünscht und so mit Macht
Mein Leben durchgestürmt; erst groß und mächtig,
Nun aber geht es weise, geht bedächtig.
Der Erdenkreis ist mir genug bekannt,
Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt;
Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,
Sich über Wolken seinesgleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um;
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen!
Was er erkennt, läßt sich ergreifen.
Er wandle so den Erdentag entlang;
Wenn Geister spuken, geh’ er seinen Gang,
Im Weiterschreiten find’ er Qual und Glück,
Er, unbefriedigt jeden Augenblick!
SORGE.
Wen ich einmal mir besitze,Dem ist alle Welt nichts nütze;
Ewiges Düstre steigt herunter,
Sonne geht nicht auf noch unter,
Bei vollkommen äußern Sinnen
Wohnen Finsternisse drinnen,
Und er weiß von allen Schätzen
Sich nicht in Besitz zu setzen.
Glück und Unglück wird zur Grille,
Er verhungert in der Fülle; …(Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Eine Tragödie. In: Hamburger Ausgabe
Hamburger Ausgabe, Hamburg 1977ff. Bd. 8. S. 344f.)
Faust muß in der Tat alles erst selbst in Erfahrung bringen und braucht dafür einen Teufelspakt mit dem genialen Mephisto, der das allumfassende Probieren und Studieren ihm erst möglich macht.—In der Faustwette geht es schließlich um die Lösung der Frage nach der Sehnsucht der Sehnsucht:
FAUST.
Werd’ ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn!
Dann mag die Totenglocke schallen,
Dann bist du deines Dienstes frei,
Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,
Es sei die Zeit für mich vorbei! (Ebd. S. 57.)
Derweil wirkt Mephisto stets so, als habe er das alles längst hinter sich und wüßte um das Wesen des Menschen, um Träume und Schäume. Dieser Dämon spricht wie ein Nihilist, der sich längst zum Zyniker gewandelt hat, und in der Tat ist Mephisto bar jeder Sehnsucht, so daß man sich fragen muß, woher er dann noch seine Energie nimmt.
Auszug aus: Heinz-Ulrich Nennen: Empathie. S. 148ff.